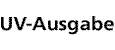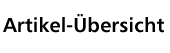International Space Station
Eine Großbaustelle in der Umlaufbahn... von Jan-Peter Lambeck
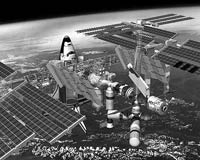 Der kalte Krieg ist vorbei, der Mond beflaggt, dieMIR kaputt und die Staatskassen leer. Schlechte Zeiten für die Raumfahrt, sollte manmeinen. Doch was wäre die Welt ohne den einen oder anderen Widerspruch. "A new staron the horizon", ein neuer Stern am Horizont - dieses Ziel verwandelt die Umlaufbahngegenwärtig in eine Großbaustelle. Seit November 1998 basteln fünfzehn Länder hier aneiner Raumstation, die alles in den Schattenstellen soll, was Menschenhände je im Allplatzierten. Name der MISSion: "International Space Station". Gleich dreimal sogroß wie die MIR soll sie werden: Sechs Laborkomplexe, zwei Versorgungsmodule und zweiWohnkomplexe sollen bis 2005 zu einer Station verschmelzen, deren Fläche souverän zweiFußballfelder überdachen könnte. Ein Koloss also, der da in "Kürze" 400 kmüber unseren Köpfen um die Erde kreisen wird. Ausgestattet mit allen Finessen derTechnik sollen die 5000 Quadratmeter im All einer siebenköpfigen Besatzung - undnatürlich auch uns - ganz neue Perspektiven verschaffen. Ein fliegendes Labor derWISSenschaft, Arbeitsplatz und Heim für eine internationale Crew, ein Symbol derVölkerverständigung und vielleicht ein "Sprungbrett" für den bemannten Flugzum Mars. Fünfzehn Länder sind an dem von den USA und Rußland geleiteten Programmbeteiligt. Unter dem Dach der European Space Agency (ESA) auch Deutschland. Und allegreifen für das Projekt tief in die Tasche - geschätzte Gesamtkosten: 200 MilliardenMark. Am 20. November 1998 flog eine russische Proton-Rakete das erste Bauteil der ISS insAll: Grundstein für einen funkelnagelneuen, internationalen und ständig bemanntenAußenposten der Menschheit im All. Die Geschichte der ISS beginnt1969 in den USA. Die junge WISSenschaft der Raumfahrt begeisterte nach der Mondlandungmindestens jeden zweiten Amerikaner. Umso erstaunlicher, dass die "US-Raumstationunter internationaler Beteiligung" fast dreißig Jahre lang auf ihre Umsetzung wartenmusste. Was im kollektiven Gedächtnis der Nachwelt über den geistigen Erfinder derStation Spiro Agnew haften blieb, ist vornehmlich sein etwas laxer Umgang mitSteuergeldern. Vielleicht auch deshalb gilt Präsident Ronald Reagan als der Vater derInternational Space Station. Vielleicht ist es aber auch einfach die lange Pause desProjekts. Fast siebzehn Jahre lang war die Idee durch NASA- und Pentagonschubladengewandert, bis die NASA 1984 den damaligen US-Präsidenten Reagan für das Vorhabengewinnen konnte. Dieser gab in jenem Jahr grünes Licht für die Umsetzung desGroßprojekts, das durch internationale Beteiligung bezahlbar werden und die Zukunft desamerikanischen Space Shuttle-Programms sichern sollte. Das ist der Startschuss für dieNASA, die sofort mit der Entwicklung der Station beginnt. Präsident Reagan gibt ihr denNamen "Freedom" und fordert international zur Teilnahme auf. Die kanadischeWeltraumorganisation CSA und die europäische Raumfahrtagentur ESA springen 1988 als ersteauf den fahrenden Zug; ein Jahr darauf folgen auch die technikbegeisterten Japaner deramerikanischen Einladung. Keine fünf Jahre später aber gerät das Raumfahrt-Projekternsthaft ins Trudeln. Der US-Kongress und Reagans Nachfolger Bill Clinton hatten denamerikanischen Raumfahrtvisionären auf die Finger geklopft, weil die Kosten für dasProjekt explodierten; die Entwicklungspläne müssen zusammengestrichen werden, soll dasVorhaben in der Haushaltsdebatte bestehen und das Parlament passieren. DasAlternativ-Konzept, das letzten Endes doch noch den parlamentarischen Segen desamerikanischen Kongresses erhielt, wird zum vorläufigenNamensgeber der komplettüberarbeiteten Station: Das Rennen macht das Entwicklungsprogramm "Alpha". 1994tritt Rußland der Baugemeinschaft bei. Aussteuer des verdienten Weltraum-Pioniers sinddie Baupläne der bis dato im Alleingang geplanten Raumstation MIR II. Die bis dahinunabhängigen Baupläne verschmelzen zu einem, die Namen "Alpha" und "MIRII" sind überholt. Das Ergebnis heißt plakativ nur noch "International SpaceStation", kurz ISS. Noch im selben Jahr dockt die amerikanische Space Shuttle an dierussische Raumstation MIR an und der Raum-Oldtimer wird zum Trainingscamp füramerikanische Astro- und russische Kosmonauten. Der 29.1.1998 schließlich ist der vonRaumfahrtlobbyisten und Forschungsministern jahrzehntelang zielstrebig vorbereitetegroßen Tag: Offizielle Vertreter von fünfzehn Ländern finden sich in Washington ein undsetzen ihre Paraphen unter das "Internationale Abkommen über den Bau und Betrieb desGemeinschaftsprojekts International Space Station." Der Bau der International SpaceStation Eine Raumstation entsteht wie ein Fertighaus: Große Baublöcke werdenvorproduziert, zusammengebaut wird vor Ort. Als die Trägerrakete PROTON am 20.11.1998 vonder gewaltigen Abschussrampe des russischen Weltraumbahnhofs Baikonur in den Kosmosaufgestiegen ist, begann die Montage der Internationalen Raumstation. An Bord der Proton:Der in russisch- amerikanischer Gemeinschaftsarbeit entwickelte Functional Cargo Block(FGB) oder auch Zarya Control Module genannt, der Grundstein der ISS. Das 23 Tonnenschwere Bauelement ist das Herz der wachsenden Station: Es wird sie auf Kurs halten und mit Strom versorgen, bis die Sonnensegel montiert sind.Außerdem birgt es den heißen Draht zur Bauleitung, dem Johnson Space Center in Houston,Texas. Im Dezember 1998 folgte ein Verbindungsknoten, eine Art Flur, an den weitereModule andocken können, das Unity Node. Doch nun begannen die ernsthafteren Probleme,denn Anfang 1999 sollte mit der amerikanischen Trägerrakete Endeavor bereits das ersteWohnmodul auf der Startrampe stehen, dieses Modul, mit dem Namen Zvezda, sollte von denrussischen Partnern gebaut werden. Doch denen ging das Geld aus. So einigten sichAmerikaner und Russen auf die Verschiebung des Starttermins auf einen Zeitpunkt nachWeihnachten. Damit ruht das gesamte Projekt erst einmal, zumindest solange, bis die Russendas Modul im All haben. Dies ist nicht das erste Mal, dass es Probleme gab, das ZaryaModul war so laut, das die Astronauten Ohrenschützer tragen mussten. Doch sollte auchdiese Hürde geschafft sein, so werden, zumindest, wenn alles nach Plan verläuft, in fastmonatlichem Abstand anschließend Solarflügel, Lebenserhaltungssysteme, Labore,Wohnmodule, Verbindungsknoten, Roboterarme ins All gebracht, eine Riesen-Zentrifuge,Bordcomputer, Fitnessgeräte, Rettungskapsel: insgesamt mehr als 80 kompakte Baublöckeund zehntausend Kabel. Wann auch immer das erste Wohnmodul bezugsfertig sein wird: ZweiRussen und ein Amerikaner sollen die Station zu diesem Zeitpunkt bereits beziehen. Siewerden allerdings neben ihren Reagenzgläsern die Schraubenzieher stets griffbereithalten: Bis 2005 geht die Montage mindestens noch weiter - und jede Hand im All wirdgebraucht. Den Transport der Bauteile übernimmt eine gemischte Flotte aus den russischenTrägerraketen "Sojus" und "Proton" (wovon die Proton Rakete, die dasWohnmodul befördern soll, mit einer Pizza Hut Reklame verschönert wurde. Einnahmen etwadrei Millionen Mark) und dem amerikanischen Space Shuttle "Endeavor"(Werbefrei). Huckepack bringen sie die Teile der Station Schritt für Schritt ins All inmehr als 45 Flügen. Zusätzliche Versorgungsflüge, bei denen die europäischeTrägerrakete Ariane 5 zum Einsatz kommen soll, nicht eingerechnet. Im Orbit gilt es dann,das Bauteil an seinen Platz zu bringen. Dass diese Montagearbeit in weiten Teilen von derErde aus gesteuert wird, dürfte nach der beeindruckenden Sojourner-MISSion auf dem Marsniemanden mehr in Erstaunen versetzen. Montageteams im All sind aber auch in den GoldenenJahren des Hightech noch unverzichtbar. Deshalb befindet sich an Bord der Trägerraketenjeweils ein Team von Astronauten, dass das mitgebrachte Bauteil andockt und dieunzähligen Kabel verbindet, die zwischen und in den Bauteilen gelegt werden müssen.Unschätzbare Montagehilfe leistet dabei der Roboterarm der Endeavor, der vom Shuttle ausgesteuert werden kann und das Rangieren und Andocken des Bauteils übernimmt. ZurFeinabstimmung der Modulverbindungen müssen die Astronauten in ihre Raumanzüge steigenund außerhalb des schützenden Shuttles arbeiten. Die fünf Amerikaner der erstenISS-Montagecrew im Orbit mussten die Endeavor während ihrer MISSion im Dezember 1998gleich dreimal verlassen, um das Grundmodul FGB mit dem zweiten Modul Node-1 zu verkabeln.2005 soll der Routinebetrieb auf der ISS beginnen können - nach der Planung derNasa solldann die Bauphase abgeschlossen sein. Gutachter des Nasa-Advisory-Council kamen aber imApril 1998 zu dem Ergebnis, dass mit der Fertigstellung der Station vernünftigerweiseerst 2007 zu rechnen sei. Dass sich schon der Start des Grundmoduls FGB um knapp fünfMonate verschoben hat, spricht für die Gutachter. Sicher ist daher nur: DerRoutinebetrieb beginnt, wenn die ISS komplett ist. Von diesem Zeitpunkt an sollen bis zusieben Menschen auf der Station leben und arbeiten. Die Andockvorrichtungen derRiesenstation erlauben zusätzlich auch regelmäßige Besuche durch Shuttle-Crews, die dieinternationalen Astronautenteams auf der Station mit Aufträgen, wISSenschaftlichenInstrumenten, Lebensmitteln und Post von der Erde versorgen. Die vorgesehene Betriebsdauervon zehn Jahren ist lediglich eine Mindestbetriebszeit: die tatsächliche Nutzdauer derStation, so lässt die längst überschrittene MIR-Betriebsdauer hoffen, ist "nachoben offen". Die beteiligten Staaten haben mehrfach darauf hingewiesen, dass sie sichEntlastungen durch Investitionen der Privatwirtschaft versprechen, wenn die ISS erst inFahrt gekommen sei. Die Idee, die dahintersteckt ist, dass industrielle Auftraggeber fürTestreihen im All Labore und Forscher anmieten und zur Beteiligung an den Shuttle-Flügenherangezogen werden können. Durch solche Investitionen könnten sich die Betriebskostenfür die Staaten deutlich verringern. Eine Studie des unabhängigen amerikanischen PotomacInstitute, das eben diese Möglichkeit einer Entlastung 1997 untersuchte, stützt dieseHoffnungen aber vorerst nicht. Die Privatwirtschaft, so das Ergebnis der Studie, haltesich zurück: die Kosten seien zu hoch, die Risiken zu groß, die wirtschaftliche Ausbeuteist den Privaten nicht kalkulierbar genug. Weltraum als Arbeitsplatz Ihr Arbeitsplatz istnicht verlockend: Ihr Vorrat an Atemluft kommt aus Maschinen, ihr maximalerBewegungsradius beträgt keinen Kilometer, ihre Körper signalisieren permanenten Stressund nach einem harten Tag sind sie weiter als jeder von uns davon entfernt, einfach nachHause gehen zu können. Die Astronauten der ISS erwartet eine unwirtliche Gegend, wennnicht der Superlativ der Unwirtlichkeit schlechthin: Je weiter man sich aufmacht genHimmel, desto ungemütlicher wird die Umgebung für jede Form des Lebens. In unsererErdatmosphäre leben wir unter einer multifunktionalen Käseglocke, die alles bereit - undvor allem "unten" - hält, was die Lebewesen dieses Planeten brauchen, und diealles abschirmt, was den hiesigen Frieden des Blühens und Gedeihens stören würde.Jenseits der Erdatmosphäre erwartet die Astronauten ein fast perfektes Vakuum. Hier undda findet sich ein einzelnes Wasserstoff- oder Heliumatom, aber das war es dann schon: anMoleküle, zuletzt Sauerstoffmoleküle, ist nicht zu denken und einen nennenswerten Druckkönnen die vereinzelten Atome auch nicht erzeugen. Auf beides ist der menschliche Körperbei der
Der kalte Krieg ist vorbei, der Mond beflaggt, dieMIR kaputt und die Staatskassen leer. Schlechte Zeiten für die Raumfahrt, sollte manmeinen. Doch was wäre die Welt ohne den einen oder anderen Widerspruch. "A new staron the horizon", ein neuer Stern am Horizont - dieses Ziel verwandelt die Umlaufbahngegenwärtig in eine Großbaustelle. Seit November 1998 basteln fünfzehn Länder hier aneiner Raumstation, die alles in den Schattenstellen soll, was Menschenhände je im Allplatzierten. Name der MISSion: "International Space Station". Gleich dreimal sogroß wie die MIR soll sie werden: Sechs Laborkomplexe, zwei Versorgungsmodule und zweiWohnkomplexe sollen bis 2005 zu einer Station verschmelzen, deren Fläche souverän zweiFußballfelder überdachen könnte. Ein Koloss also, der da in "Kürze" 400 kmüber unseren Köpfen um die Erde kreisen wird. Ausgestattet mit allen Finessen derTechnik sollen die 5000 Quadratmeter im All einer siebenköpfigen Besatzung - undnatürlich auch uns - ganz neue Perspektiven verschaffen. Ein fliegendes Labor derWISSenschaft, Arbeitsplatz und Heim für eine internationale Crew, ein Symbol derVölkerverständigung und vielleicht ein "Sprungbrett" für den bemannten Flugzum Mars. Fünfzehn Länder sind an dem von den USA und Rußland geleiteten Programmbeteiligt. Unter dem Dach der European Space Agency (ESA) auch Deutschland. Und allegreifen für das Projekt tief in die Tasche - geschätzte Gesamtkosten: 200 MilliardenMark. Am 20. November 1998 flog eine russische Proton-Rakete das erste Bauteil der ISS insAll: Grundstein für einen funkelnagelneuen, internationalen und ständig bemanntenAußenposten der Menschheit im All. Die Geschichte der ISS beginnt1969 in den USA. Die junge WISSenschaft der Raumfahrt begeisterte nach der Mondlandungmindestens jeden zweiten Amerikaner. Umso erstaunlicher, dass die "US-Raumstationunter internationaler Beteiligung" fast dreißig Jahre lang auf ihre Umsetzung wartenmusste. Was im kollektiven Gedächtnis der Nachwelt über den geistigen Erfinder derStation Spiro Agnew haften blieb, ist vornehmlich sein etwas laxer Umgang mitSteuergeldern. Vielleicht auch deshalb gilt Präsident Ronald Reagan als der Vater derInternational Space Station. Vielleicht ist es aber auch einfach die lange Pause desProjekts. Fast siebzehn Jahre lang war die Idee durch NASA- und Pentagonschubladengewandert, bis die NASA 1984 den damaligen US-Präsidenten Reagan für das Vorhabengewinnen konnte. Dieser gab in jenem Jahr grünes Licht für die Umsetzung desGroßprojekts, das durch internationale Beteiligung bezahlbar werden und die Zukunft desamerikanischen Space Shuttle-Programms sichern sollte. Das ist der Startschuss für dieNASA, die sofort mit der Entwicklung der Station beginnt. Präsident Reagan gibt ihr denNamen "Freedom" und fordert international zur Teilnahme auf. Die kanadischeWeltraumorganisation CSA und die europäische Raumfahrtagentur ESA springen 1988 als ersteauf den fahrenden Zug; ein Jahr darauf folgen auch die technikbegeisterten Japaner deramerikanischen Einladung. Keine fünf Jahre später aber gerät das Raumfahrt-Projekternsthaft ins Trudeln. Der US-Kongress und Reagans Nachfolger Bill Clinton hatten denamerikanischen Raumfahrtvisionären auf die Finger geklopft, weil die Kosten für dasProjekt explodierten; die Entwicklungspläne müssen zusammengestrichen werden, soll dasVorhaben in der Haushaltsdebatte bestehen und das Parlament passieren. DasAlternativ-Konzept, das letzten Endes doch noch den parlamentarischen Segen desamerikanischen Kongresses erhielt, wird zum vorläufigenNamensgeber der komplettüberarbeiteten Station: Das Rennen macht das Entwicklungsprogramm "Alpha". 1994tritt Rußland der Baugemeinschaft bei. Aussteuer des verdienten Weltraum-Pioniers sinddie Baupläne der bis dato im Alleingang geplanten Raumstation MIR II. Die bis dahinunabhängigen Baupläne verschmelzen zu einem, die Namen "Alpha" und "MIRII" sind überholt. Das Ergebnis heißt plakativ nur noch "International SpaceStation", kurz ISS. Noch im selben Jahr dockt die amerikanische Space Shuttle an dierussische Raumstation MIR an und der Raum-Oldtimer wird zum Trainingscamp füramerikanische Astro- und russische Kosmonauten. Der 29.1.1998 schließlich ist der vonRaumfahrtlobbyisten und Forschungsministern jahrzehntelang zielstrebig vorbereitetegroßen Tag: Offizielle Vertreter von fünfzehn Ländern finden sich in Washington ein undsetzen ihre Paraphen unter das "Internationale Abkommen über den Bau und Betrieb desGemeinschaftsprojekts International Space Station." Der Bau der International SpaceStation Eine Raumstation entsteht wie ein Fertighaus: Große Baublöcke werdenvorproduziert, zusammengebaut wird vor Ort. Als die Trägerrakete PROTON am 20.11.1998 vonder gewaltigen Abschussrampe des russischen Weltraumbahnhofs Baikonur in den Kosmosaufgestiegen ist, begann die Montage der Internationalen Raumstation. An Bord der Proton:Der in russisch- amerikanischer Gemeinschaftsarbeit entwickelte Functional Cargo Block(FGB) oder auch Zarya Control Module genannt, der Grundstein der ISS. Das 23 Tonnenschwere Bauelement ist das Herz der wachsenden Station: Es wird sie auf Kurs halten und mit Strom versorgen, bis die Sonnensegel montiert sind.Außerdem birgt es den heißen Draht zur Bauleitung, dem Johnson Space Center in Houston,Texas. Im Dezember 1998 folgte ein Verbindungsknoten, eine Art Flur, an den weitereModule andocken können, das Unity Node. Doch nun begannen die ernsthafteren Probleme,denn Anfang 1999 sollte mit der amerikanischen Trägerrakete Endeavor bereits das ersteWohnmodul auf der Startrampe stehen, dieses Modul, mit dem Namen Zvezda, sollte von denrussischen Partnern gebaut werden. Doch denen ging das Geld aus. So einigten sichAmerikaner und Russen auf die Verschiebung des Starttermins auf einen Zeitpunkt nachWeihnachten. Damit ruht das gesamte Projekt erst einmal, zumindest solange, bis die Russendas Modul im All haben. Dies ist nicht das erste Mal, dass es Probleme gab, das ZaryaModul war so laut, das die Astronauten Ohrenschützer tragen mussten. Doch sollte auchdiese Hürde geschafft sein, so werden, zumindest, wenn alles nach Plan verläuft, in fastmonatlichem Abstand anschließend Solarflügel, Lebenserhaltungssysteme, Labore,Wohnmodule, Verbindungsknoten, Roboterarme ins All gebracht, eine Riesen-Zentrifuge,Bordcomputer, Fitnessgeräte, Rettungskapsel: insgesamt mehr als 80 kompakte Baublöckeund zehntausend Kabel. Wann auch immer das erste Wohnmodul bezugsfertig sein wird: ZweiRussen und ein Amerikaner sollen die Station zu diesem Zeitpunkt bereits beziehen. Siewerden allerdings neben ihren Reagenzgläsern die Schraubenzieher stets griffbereithalten: Bis 2005 geht die Montage mindestens noch weiter - und jede Hand im All wirdgebraucht. Den Transport der Bauteile übernimmt eine gemischte Flotte aus den russischenTrägerraketen "Sojus" und "Proton" (wovon die Proton Rakete, die dasWohnmodul befördern soll, mit einer Pizza Hut Reklame verschönert wurde. Einnahmen etwadrei Millionen Mark) und dem amerikanischen Space Shuttle "Endeavor"(Werbefrei). Huckepack bringen sie die Teile der Station Schritt für Schritt ins All inmehr als 45 Flügen. Zusätzliche Versorgungsflüge, bei denen die europäischeTrägerrakete Ariane 5 zum Einsatz kommen soll, nicht eingerechnet. Im Orbit gilt es dann,das Bauteil an seinen Platz zu bringen. Dass diese Montagearbeit in weiten Teilen von derErde aus gesteuert wird, dürfte nach der beeindruckenden Sojourner-MISSion auf dem Marsniemanden mehr in Erstaunen versetzen. Montageteams im All sind aber auch in den GoldenenJahren des Hightech noch unverzichtbar. Deshalb befindet sich an Bord der Trägerraketenjeweils ein Team von Astronauten, dass das mitgebrachte Bauteil andockt und dieunzähligen Kabel verbindet, die zwischen und in den Bauteilen gelegt werden müssen.Unschätzbare Montagehilfe leistet dabei der Roboterarm der Endeavor, der vom Shuttle ausgesteuert werden kann und das Rangieren und Andocken des Bauteils übernimmt. ZurFeinabstimmung der Modulverbindungen müssen die Astronauten in ihre Raumanzüge steigenund außerhalb des schützenden Shuttles arbeiten. Die fünf Amerikaner der erstenISS-Montagecrew im Orbit mussten die Endeavor während ihrer MISSion im Dezember 1998gleich dreimal verlassen, um das Grundmodul FGB mit dem zweiten Modul Node-1 zu verkabeln.2005 soll der Routinebetrieb auf der ISS beginnen können - nach der Planung derNasa solldann die Bauphase abgeschlossen sein. Gutachter des Nasa-Advisory-Council kamen aber imApril 1998 zu dem Ergebnis, dass mit der Fertigstellung der Station vernünftigerweiseerst 2007 zu rechnen sei. Dass sich schon der Start des Grundmoduls FGB um knapp fünfMonate verschoben hat, spricht für die Gutachter. Sicher ist daher nur: DerRoutinebetrieb beginnt, wenn die ISS komplett ist. Von diesem Zeitpunkt an sollen bis zusieben Menschen auf der Station leben und arbeiten. Die Andockvorrichtungen derRiesenstation erlauben zusätzlich auch regelmäßige Besuche durch Shuttle-Crews, die dieinternationalen Astronautenteams auf der Station mit Aufträgen, wISSenschaftlichenInstrumenten, Lebensmitteln und Post von der Erde versorgen. Die vorgesehene Betriebsdauervon zehn Jahren ist lediglich eine Mindestbetriebszeit: die tatsächliche Nutzdauer derStation, so lässt die längst überschrittene MIR-Betriebsdauer hoffen, ist "nachoben offen". Die beteiligten Staaten haben mehrfach darauf hingewiesen, dass sie sichEntlastungen durch Investitionen der Privatwirtschaft versprechen, wenn die ISS erst inFahrt gekommen sei. Die Idee, die dahintersteckt ist, dass industrielle Auftraggeber fürTestreihen im All Labore und Forscher anmieten und zur Beteiligung an den Shuttle-Flügenherangezogen werden können. Durch solche Investitionen könnten sich die Betriebskostenfür die Staaten deutlich verringern. Eine Studie des unabhängigen amerikanischen PotomacInstitute, das eben diese Möglichkeit einer Entlastung 1997 untersuchte, stützt dieseHoffnungen aber vorerst nicht. Die Privatwirtschaft, so das Ergebnis der Studie, haltesich zurück: die Kosten seien zu hoch, die Risiken zu groß, die wirtschaftliche Ausbeuteist den Privaten nicht kalkulierbar genug. Weltraum als Arbeitsplatz Ihr Arbeitsplatz istnicht verlockend: Ihr Vorrat an Atemluft kommt aus Maschinen, ihr maximalerBewegungsradius beträgt keinen Kilometer, ihre Körper signalisieren permanenten Stressund nach einem harten Tag sind sie weiter als jeder von uns davon entfernt, einfach nachHause gehen zu können. Die Astronauten der ISS erwartet eine unwirtliche Gegend, wennnicht der Superlativ der Unwirtlichkeit schlechthin: Je weiter man sich aufmacht genHimmel, desto ungemütlicher wird die Umgebung für jede Form des Lebens. In unsererErdatmosphäre leben wir unter einer multifunktionalen Käseglocke, die alles bereit - undvor allem "unten" - hält, was die Lebewesen dieses Planeten brauchen, und diealles abschirmt, was den hiesigen Frieden des Blühens und Gedeihens stören würde.Jenseits der Erdatmosphäre erwartet die Astronauten ein fast perfektes Vakuum. Hier undda findet sich ein einzelnes Wasserstoff- oder Heliumatom, aber das war es dann schon: anMoleküle, zuletzt Sauerstoffmoleküle, ist nicht zu denken und einen nennenswerten Druckkönnen die vereinzelten Atome auch nicht erzeugen. Auf beides ist der menschliche Körperbei der  Atmung allerdings angewiesen, was bedeutet, dass die Astronautenohne das bewährte Atemluftgemisch der Erde und den atmosphärischen Druck jämmerlichersticken würden. Im Raumschiff herrschen deshalb dieselben Druck- und LuftverhältnISSe,wie auf der Erde. Aber nicht nur das Vakuum, auch die Temperaturen machen das ReisezielKosmos nicht verlockend. Das All ist ein Temperatur-Abenteuer. Im Prinzip ist es extremkalt, deshalb besteht der Schutzanzug eines Astronauten aus mehreren Schichtenisolierenden Materials, das ihn vor dem Erfrieren schützt. Im Weltall ist es allerdingsnur deshalbextrem kalt, weil es leer ist. Die Strahlung der Sonne trifft, abgesehen vonden Planeten, auf nichts, was sie absorbieren und die Energie in Wärme umwandeln würde.Sofern aber ein Astronaut inmitten des Nichts anzutreffen ist, bietet sich eineUmwandlungsfläche. Dieser Fall würde für den Betroffenen ziemlich heiß werden, denndas, was auf der Erdoberfläche in einer durch 400 km Atmosphäre abgemilderten Formankommt, träfe ihn in ungemilderter Form. Raumschiff und Raumanzüge müssen dieAstronauten daher nicht nur vor extrem niedrigen, sondern auch vor extrem hohenTemperaturen schützen. Auch unter der Schutzglocke Erdatmosphäre nimmt der menschlicheKörper noch relativ viele Strahlen auf, wenn er der Sonne lange und ungeschütztausgesetzt wird. Dabei ist es nur ultraviolette Strahlung, die bis in die Troposphärevordringt, und auch noch in geringen Mengen. Man braucht schon etwas Fantasie, um sichvorzustellen, in welcher Verfassung ein menschlicher Körper aus der Konfrontation mit denweit gefährlicheren radioaktiven Gamma- und Röntgenstrahlen jenseits der Atmosphärehervorgehen würde. Diese Strahlen haben die unangenehme Eigenschaft, Elektronen ausAtomen herauszuschießen, gleichgültig, wem das Atom gehört. Physiker nennen den Vorgangwertneutral "ionisierende Wirkung" der radioaktiven Strahlung, vor der man denAstronauten sowohl im, als auch außerhalb des Raumschiffs bewahren muss. Daher ist esvielleicht kein Zufall, dass die Astronautenanzüge eine gewISSe ähnlichkeit haben mitden Schutzanzügen, die in Kernkraftwerken getragen werden - dieselbe Schutzrichtungsollten sie auf jeden Fall haben. Das 400km dicke Dach unseres Planeten kann man sich alsdichten Filter vorstellen, der in zwei Richtungen gleichzeitig arbeitet. Der Filter vonunten nach oben sorgt dafür, dass unten bleibt, was den Lebenskreislauf auf der Erde inGang hält, vornehmlich Luft und Wärme. Und in entgegengesetzter Richtung - von oben nachunten - wird ausgefiltert, was aus dem All nicht auf die Erde fallen soll. Zum Beispielschädliche Strahlen, praktischerweise aber auch fallende Himmelskörper: kleineMeteoriten oder - neuerdings - Weltraumschrott, kaputte Satelliten, verlorene Werkzeugeund abstürzende Teile ausrangierter Raumstationen, die meist in der Erdatmosphäreverglühen. Was aber bringt die ISS? Kritiker meinen nicht viel. Abgesehen von frischenAufträgen für die Raumfahrtindustrie, bunten Bildern aus dem All und noch mehr Müll inder Umlaufbahn. Die Bauherren sind naturgemäß anderer Meinung. Sie erwartenQuantensprünge in Sachen Technik und eine florierende industrielle Nutzung derErkenntnISSe aus dem All. Ohne Visionen kein Fortschritt, ohne Fortschritt keineArbeitsplätze, ohne Arbeitsplätze keine Zukunft. Allerdings räumten sie bereits ein,dass die WISSenschaft nicht Hauptnutznießer der ISS sein soll. Im Vordergrund stehe dieTechnik, Wirtschaft und industrielle Nutzung der ErkenntnISSe aus dem All. Deshalb seienauch die Kosten vertretbar. Die NASA hat dem amerikanischen Steuerzahler errechnet, dasser für jeden investierten Steuerdollar drei Dollar wieder zurückbekommt - über dieSteuergelder, die die Industrie vermehrt zahle, wenn die Umsätze dank der Forschung imAll stiegen. Wie der Bau der ISS selbst soll auch ein großer Teil der Forschungsvorhabenauf der Station der technologischen Entwicklung dienen. Neue Produkte, verbesserteProduktionsprozesse, Wettbewerbsvorteile, neue Jobs und höhere Lebensqualität. Dasin etwa sind die Schlagworte der beteiligten Staaten. Deutschland will unter anderem einenSender testen, mit dem per Satellit gestohlene Autos aufgespürt und lahmgelegt werdenkönnen. Das soll auch für Scheckkarten und Handys taugen. Der Praxistest im All kostet1,5 Millionen Mark. Es dürfte sich dabei um das einzige Vorhaben handeln, in dem es darum geht, Mobiltelefone lahmzulegend. Ansonsten gilt: DieKommunikationstechnologie soll vorangetrieben werden, die Satellitennutzung für privateTelefone, Computer, Bildübertragung richtig in Schwung kommen. Denn wenn es nach derTelekommunikationsbranche geht, wird es im All bald eng: Bis 2001 sollen fast 600 neueKommunikationssatelliten in der Umlaufbahn sein und die erdgebundene Kommunikation insMuseum verweisen. Im Außenlabor der ISS soll die Hardware der Satellitensysteme auf ihreEignung für den Einsatz im All vorab getestet werden. Nötig scheint das zu sein: Deramerikanische Elektronikkonzern Motorola musste schon sieben seiner 66 nagelneuenSatelliten abstürzen sehen, den "Motorola"-Börsenkurs zum Entsetzen derBeteiligten gleich mit. Proteinanalysen, die im All einfacher sind, sollen zur Entwicklungneuer Medikamente auf der Erde führen. Die NASA erhofft sich von den AnalysenFortschritte in der Krebs-, und Diabetesforschung wie auch im Kampf gegen Schwächen desImmunsystems. Dieses Ziel wird allerdings schon seit den Jugendtagen der MIR angestrebt;bisher ohne Erfolg. Auf der besser ausgestatteten ISS will man es jetzt noch einmalwISSen. Die Schwerelosigkeitsforschung steht natürlich ebenfalls auf demISS-Forschungsprogramm. Raumstationen halten hier quasi ein Monopol, weil dieSchwerelosigkeit im Raum auf der Erde naturgemäß nicht simulierbar ist.Forschungsschwerpunkte auf der ISS sind Einfluss der Schwerelosigkeit auf Wachstum undEntwicklung, sowie auf Molekülstrukturen. Das soll über die Rolle der Gravitation in derEvolution und im Ablauf biologischer Prozesse Aufschluss geben. Außerdem sollen dieAstronauten der ISS die körperlichen Auswirkungen eines Weltraumaufenthalts erforschen.Das ist für die Weltraumfahrer Forschung in eigener Sache: Aus den ErkenntnISSen gilt esMöglichkeiten zu entwickeln, die Langzeitaufenthalte im All erträglich machen. DieseForschung soll bemannte MISSionen zum Mars in greifbare Nähe rücken lassen. Die NASA hatsich neben den klassischen Forschungsdisziplinen ein weiteres Ziel auf die Fahnengeschrieben, das bisher eher im Bereich der Science Fiction Romane vermutet werden würde:Die ISS soll "eine Plattform sein für "die wirtschaftliche Nutzbarmachung desWeltraums" und die bemannte Landung auf dem Mars. Unter Ersteres fällt unter anderemdas NASA-Projekt "Mondstation", mit dem sich WISSenschaftler bereits seit 1982beschäftigen. Die ISS könnte ihrer Meinung nach eine geeignete Zwischenstation auf derReise zum Mond werden und ihnen die Aufgabe erleichtern, auch den Mond zur Großbaustellezu machen. Auch das Vorhaben "bemannte Marslandung" ist längst mehr als nureine fixe Idee. Damit liebäugeln die USA schon lange: Immerhin seit den 70er Jahrenbeschäftigt sich die NASA konkret mit Programmen namens ALS (Advanced Life Support) undLMLSTP (Lunar-Mars Life SupportTest Project). Darin geht es im wesentlichen um dieHerstellung regenerativer Nahrungs-, Sauerstoff- und Energiequellen außerhalb derErdatmosphäre. Lebenserhaltungssysteme dieser Art sind unter simulierten Bedingungen imJohnson Space Center bereits dreimal mit Freiwilligen getestet worden, zuletzt 1997 ineiner Versuchsdauer von 60 Tagen. Sie sollen die "Selbstversorgung" derMannschaft während des Fluges zum roten Planeten ermöglichen - und immerhin kann man denFlug dank technischer Fortschritte inzwischen in knapp 200 Tagen schaffen. Die in derTestphase 1997 erprobten Technologien werden allerdings schon vor dem Marsflug in Gebrauchsein - sie werden bereits an Bord der ISS zum Einsatz kommen.
Atmung allerdings angewiesen, was bedeutet, dass die Astronautenohne das bewährte Atemluftgemisch der Erde und den atmosphärischen Druck jämmerlichersticken würden. Im Raumschiff herrschen deshalb dieselben Druck- und LuftverhältnISSe,wie auf der Erde. Aber nicht nur das Vakuum, auch die Temperaturen machen das ReisezielKosmos nicht verlockend. Das All ist ein Temperatur-Abenteuer. Im Prinzip ist es extremkalt, deshalb besteht der Schutzanzug eines Astronauten aus mehreren Schichtenisolierenden Materials, das ihn vor dem Erfrieren schützt. Im Weltall ist es allerdingsnur deshalbextrem kalt, weil es leer ist. Die Strahlung der Sonne trifft, abgesehen vonden Planeten, auf nichts, was sie absorbieren und die Energie in Wärme umwandeln würde.Sofern aber ein Astronaut inmitten des Nichts anzutreffen ist, bietet sich eineUmwandlungsfläche. Dieser Fall würde für den Betroffenen ziemlich heiß werden, denndas, was auf der Erdoberfläche in einer durch 400 km Atmosphäre abgemilderten Formankommt, träfe ihn in ungemilderter Form. Raumschiff und Raumanzüge müssen dieAstronauten daher nicht nur vor extrem niedrigen, sondern auch vor extrem hohenTemperaturen schützen. Auch unter der Schutzglocke Erdatmosphäre nimmt der menschlicheKörper noch relativ viele Strahlen auf, wenn er der Sonne lange und ungeschütztausgesetzt wird. Dabei ist es nur ultraviolette Strahlung, die bis in die Troposphärevordringt, und auch noch in geringen Mengen. Man braucht schon etwas Fantasie, um sichvorzustellen, in welcher Verfassung ein menschlicher Körper aus der Konfrontation mit denweit gefährlicheren radioaktiven Gamma- und Röntgenstrahlen jenseits der Atmosphärehervorgehen würde. Diese Strahlen haben die unangenehme Eigenschaft, Elektronen ausAtomen herauszuschießen, gleichgültig, wem das Atom gehört. Physiker nennen den Vorgangwertneutral "ionisierende Wirkung" der radioaktiven Strahlung, vor der man denAstronauten sowohl im, als auch außerhalb des Raumschiffs bewahren muss. Daher ist esvielleicht kein Zufall, dass die Astronautenanzüge eine gewISSe ähnlichkeit haben mitden Schutzanzügen, die in Kernkraftwerken getragen werden - dieselbe Schutzrichtungsollten sie auf jeden Fall haben. Das 400km dicke Dach unseres Planeten kann man sich alsdichten Filter vorstellen, der in zwei Richtungen gleichzeitig arbeitet. Der Filter vonunten nach oben sorgt dafür, dass unten bleibt, was den Lebenskreislauf auf der Erde inGang hält, vornehmlich Luft und Wärme. Und in entgegengesetzter Richtung - von oben nachunten - wird ausgefiltert, was aus dem All nicht auf die Erde fallen soll. Zum Beispielschädliche Strahlen, praktischerweise aber auch fallende Himmelskörper: kleineMeteoriten oder - neuerdings - Weltraumschrott, kaputte Satelliten, verlorene Werkzeugeund abstürzende Teile ausrangierter Raumstationen, die meist in der Erdatmosphäreverglühen. Was aber bringt die ISS? Kritiker meinen nicht viel. Abgesehen von frischenAufträgen für die Raumfahrtindustrie, bunten Bildern aus dem All und noch mehr Müll inder Umlaufbahn. Die Bauherren sind naturgemäß anderer Meinung. Sie erwartenQuantensprünge in Sachen Technik und eine florierende industrielle Nutzung derErkenntnISSe aus dem All. Ohne Visionen kein Fortschritt, ohne Fortschritt keineArbeitsplätze, ohne Arbeitsplätze keine Zukunft. Allerdings räumten sie bereits ein,dass die WISSenschaft nicht Hauptnutznießer der ISS sein soll. Im Vordergrund stehe dieTechnik, Wirtschaft und industrielle Nutzung der ErkenntnISSe aus dem All. Deshalb seienauch die Kosten vertretbar. Die NASA hat dem amerikanischen Steuerzahler errechnet, dasser für jeden investierten Steuerdollar drei Dollar wieder zurückbekommt - über dieSteuergelder, die die Industrie vermehrt zahle, wenn die Umsätze dank der Forschung imAll stiegen. Wie der Bau der ISS selbst soll auch ein großer Teil der Forschungsvorhabenauf der Station der technologischen Entwicklung dienen. Neue Produkte, verbesserteProduktionsprozesse, Wettbewerbsvorteile, neue Jobs und höhere Lebensqualität. Dasin etwa sind die Schlagworte der beteiligten Staaten. Deutschland will unter anderem einenSender testen, mit dem per Satellit gestohlene Autos aufgespürt und lahmgelegt werdenkönnen. Das soll auch für Scheckkarten und Handys taugen. Der Praxistest im All kostet1,5 Millionen Mark. Es dürfte sich dabei um das einzige Vorhaben handeln, in dem es darum geht, Mobiltelefone lahmzulegend. Ansonsten gilt: DieKommunikationstechnologie soll vorangetrieben werden, die Satellitennutzung für privateTelefone, Computer, Bildübertragung richtig in Schwung kommen. Denn wenn es nach derTelekommunikationsbranche geht, wird es im All bald eng: Bis 2001 sollen fast 600 neueKommunikationssatelliten in der Umlaufbahn sein und die erdgebundene Kommunikation insMuseum verweisen. Im Außenlabor der ISS soll die Hardware der Satellitensysteme auf ihreEignung für den Einsatz im All vorab getestet werden. Nötig scheint das zu sein: Deramerikanische Elektronikkonzern Motorola musste schon sieben seiner 66 nagelneuenSatelliten abstürzen sehen, den "Motorola"-Börsenkurs zum Entsetzen derBeteiligten gleich mit. Proteinanalysen, die im All einfacher sind, sollen zur Entwicklungneuer Medikamente auf der Erde führen. Die NASA erhofft sich von den AnalysenFortschritte in der Krebs-, und Diabetesforschung wie auch im Kampf gegen Schwächen desImmunsystems. Dieses Ziel wird allerdings schon seit den Jugendtagen der MIR angestrebt;bisher ohne Erfolg. Auf der besser ausgestatteten ISS will man es jetzt noch einmalwISSen. Die Schwerelosigkeitsforschung steht natürlich ebenfalls auf demISS-Forschungsprogramm. Raumstationen halten hier quasi ein Monopol, weil dieSchwerelosigkeit im Raum auf der Erde naturgemäß nicht simulierbar ist.Forschungsschwerpunkte auf der ISS sind Einfluss der Schwerelosigkeit auf Wachstum undEntwicklung, sowie auf Molekülstrukturen. Das soll über die Rolle der Gravitation in derEvolution und im Ablauf biologischer Prozesse Aufschluss geben. Außerdem sollen dieAstronauten der ISS die körperlichen Auswirkungen eines Weltraumaufenthalts erforschen.Das ist für die Weltraumfahrer Forschung in eigener Sache: Aus den ErkenntnISSen gilt esMöglichkeiten zu entwickeln, die Langzeitaufenthalte im All erträglich machen. DieseForschung soll bemannte MISSionen zum Mars in greifbare Nähe rücken lassen. Die NASA hatsich neben den klassischen Forschungsdisziplinen ein weiteres Ziel auf die Fahnengeschrieben, das bisher eher im Bereich der Science Fiction Romane vermutet werden würde:Die ISS soll "eine Plattform sein für "die wirtschaftliche Nutzbarmachung desWeltraums" und die bemannte Landung auf dem Mars. Unter Ersteres fällt unter anderemdas NASA-Projekt "Mondstation", mit dem sich WISSenschaftler bereits seit 1982beschäftigen. Die ISS könnte ihrer Meinung nach eine geeignete Zwischenstation auf derReise zum Mond werden und ihnen die Aufgabe erleichtern, auch den Mond zur Großbaustellezu machen. Auch das Vorhaben "bemannte Marslandung" ist längst mehr als nureine fixe Idee. Damit liebäugeln die USA schon lange: Immerhin seit den 70er Jahrenbeschäftigt sich die NASA konkret mit Programmen namens ALS (Advanced Life Support) undLMLSTP (Lunar-Mars Life SupportTest Project). Darin geht es im wesentlichen um dieHerstellung regenerativer Nahrungs-, Sauerstoff- und Energiequellen außerhalb derErdatmosphäre. Lebenserhaltungssysteme dieser Art sind unter simulierten Bedingungen imJohnson Space Center bereits dreimal mit Freiwilligen getestet worden, zuletzt 1997 ineiner Versuchsdauer von 60 Tagen. Sie sollen die "Selbstversorgung" derMannschaft während des Fluges zum roten Planeten ermöglichen - und immerhin kann man denFlug dank technischer Fortschritte inzwischen in knapp 200 Tagen schaffen. Die in derTestphase 1997 erprobten Technologien werden allerdings schon vor dem Marsflug in Gebrauchsein - sie werden bereits an Bord der ISS zum Einsatz kommen.
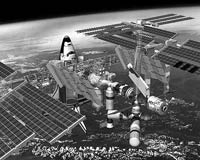 Der kalte Krieg ist vorbei, der Mond beflaggt, dieMIR kaputt und die Staatskassen leer. Schlechte Zeiten für die Raumfahrt, sollte manmeinen. Doch was wäre die Welt ohne den einen oder anderen Widerspruch. "A new staron the horizon", ein neuer Stern am Horizont - dieses Ziel verwandelt die Umlaufbahngegenwärtig in eine Großbaustelle. Seit November 1998 basteln fünfzehn Länder hier aneiner Raumstation, die alles in den Schattenstellen soll, was Menschenhände je im Allplatzierten. Name der MISSion: "International Space Station". Gleich dreimal sogroß wie die MIR soll sie werden: Sechs Laborkomplexe, zwei Versorgungsmodule und zweiWohnkomplexe sollen bis 2005 zu einer Station verschmelzen, deren Fläche souverän zweiFußballfelder überdachen könnte. Ein Koloss also, der da in "Kürze" 400 kmüber unseren Köpfen um die Erde kreisen wird. Ausgestattet mit allen Finessen derTechnik sollen die 5000 Quadratmeter im All einer siebenköpfigen Besatzung - undnatürlich auch uns - ganz neue Perspektiven verschaffen. Ein fliegendes Labor derWISSenschaft, Arbeitsplatz und Heim für eine internationale Crew, ein Symbol derVölkerverständigung und vielleicht ein "Sprungbrett" für den bemannten Flugzum Mars. Fünfzehn Länder sind an dem von den USA und Rußland geleiteten Programmbeteiligt. Unter dem Dach der European Space Agency (ESA) auch Deutschland. Und allegreifen für das Projekt tief in die Tasche - geschätzte Gesamtkosten: 200 MilliardenMark. Am 20. November 1998 flog eine russische Proton-Rakete das erste Bauteil der ISS insAll: Grundstein für einen funkelnagelneuen, internationalen und ständig bemanntenAußenposten der Menschheit im All. Die Geschichte der ISS beginnt1969 in den USA. Die junge WISSenschaft der Raumfahrt begeisterte nach der Mondlandungmindestens jeden zweiten Amerikaner. Umso erstaunlicher, dass die "US-Raumstationunter internationaler Beteiligung" fast dreißig Jahre lang auf ihre Umsetzung wartenmusste. Was im kollektiven Gedächtnis der Nachwelt über den geistigen Erfinder derStation Spiro Agnew haften blieb, ist vornehmlich sein etwas laxer Umgang mitSteuergeldern. Vielleicht auch deshalb gilt Präsident Ronald Reagan als der Vater derInternational Space Station. Vielleicht ist es aber auch einfach die lange Pause desProjekts. Fast siebzehn Jahre lang war die Idee durch NASA- und Pentagonschubladengewandert, bis die NASA 1984 den damaligen US-Präsidenten Reagan für das Vorhabengewinnen konnte. Dieser gab in jenem Jahr grünes Licht für die Umsetzung desGroßprojekts, das durch internationale Beteiligung bezahlbar werden und die Zukunft desamerikanischen Space Shuttle-Programms sichern sollte. Das ist der Startschuss für dieNASA, die sofort mit der Entwicklung der Station beginnt. Präsident Reagan gibt ihr denNamen "Freedom" und fordert international zur Teilnahme auf. Die kanadischeWeltraumorganisation CSA und die europäische Raumfahrtagentur ESA springen 1988 als ersteauf den fahrenden Zug; ein Jahr darauf folgen auch die technikbegeisterten Japaner deramerikanischen Einladung. Keine fünf Jahre später aber gerät das Raumfahrt-Projekternsthaft ins Trudeln. Der US-Kongress und Reagans Nachfolger Bill Clinton hatten denamerikanischen Raumfahrtvisionären auf die Finger geklopft, weil die Kosten für dasProjekt explodierten; die Entwicklungspläne müssen zusammengestrichen werden, soll dasVorhaben in der Haushaltsdebatte bestehen und das Parlament passieren. DasAlternativ-Konzept, das letzten Endes doch noch den parlamentarischen Segen desamerikanischen Kongresses erhielt, wird zum vorläufigenNamensgeber der komplettüberarbeiteten Station: Das Rennen macht das Entwicklungsprogramm "Alpha". 1994tritt Rußland der Baugemeinschaft bei. Aussteuer des verdienten Weltraum-Pioniers sinddie Baupläne der bis dato im Alleingang geplanten Raumstation MIR II. Die bis dahinunabhängigen Baupläne verschmelzen zu einem, die Namen "Alpha" und "MIRII" sind überholt. Das Ergebnis heißt plakativ nur noch "International SpaceStation", kurz ISS. Noch im selben Jahr dockt die amerikanische Space Shuttle an dierussische Raumstation MIR an und der Raum-Oldtimer wird zum Trainingscamp füramerikanische Astro- und russische Kosmonauten. Der 29.1.1998 schließlich ist der vonRaumfahrtlobbyisten und Forschungsministern jahrzehntelang zielstrebig vorbereitetegroßen Tag: Offizielle Vertreter von fünfzehn Ländern finden sich in Washington ein undsetzen ihre Paraphen unter das "Internationale Abkommen über den Bau und Betrieb desGemeinschaftsprojekts International Space Station." Der Bau der International SpaceStation Eine Raumstation entsteht wie ein Fertighaus: Große Baublöcke werdenvorproduziert, zusammengebaut wird vor Ort. Als die Trägerrakete PROTON am 20.11.1998 vonder gewaltigen Abschussrampe des russischen Weltraumbahnhofs Baikonur in den Kosmosaufgestiegen ist, begann die Montage der Internationalen Raumstation. An Bord der Proton:Der in russisch- amerikanischer Gemeinschaftsarbeit entwickelte Functional Cargo Block(FGB) oder auch Zarya Control Module genannt, der Grundstein der ISS. Das 23 Tonnenschwere Bauelement ist das Herz der wachsenden Station: Es wird sie
Der kalte Krieg ist vorbei, der Mond beflaggt, dieMIR kaputt und die Staatskassen leer. Schlechte Zeiten für die Raumfahrt, sollte manmeinen. Doch was wäre die Welt ohne den einen oder anderen Widerspruch. "A new staron the horizon", ein neuer Stern am Horizont - dieses Ziel verwandelt die Umlaufbahngegenwärtig in eine Großbaustelle. Seit November 1998 basteln fünfzehn Länder hier aneiner Raumstation, die alles in den Schattenstellen soll, was Menschenhände je im Allplatzierten. Name der MISSion: "International Space Station". Gleich dreimal sogroß wie die MIR soll sie werden: Sechs Laborkomplexe, zwei Versorgungsmodule und zweiWohnkomplexe sollen bis 2005 zu einer Station verschmelzen, deren Fläche souverän zweiFußballfelder überdachen könnte. Ein Koloss also, der da in "Kürze" 400 kmüber unseren Köpfen um die Erde kreisen wird. Ausgestattet mit allen Finessen derTechnik sollen die 5000 Quadratmeter im All einer siebenköpfigen Besatzung - undnatürlich auch uns - ganz neue Perspektiven verschaffen. Ein fliegendes Labor derWISSenschaft, Arbeitsplatz und Heim für eine internationale Crew, ein Symbol derVölkerverständigung und vielleicht ein "Sprungbrett" für den bemannten Flugzum Mars. Fünfzehn Länder sind an dem von den USA und Rußland geleiteten Programmbeteiligt. Unter dem Dach der European Space Agency (ESA) auch Deutschland. Und allegreifen für das Projekt tief in die Tasche - geschätzte Gesamtkosten: 200 MilliardenMark. Am 20. November 1998 flog eine russische Proton-Rakete das erste Bauteil der ISS insAll: Grundstein für einen funkelnagelneuen, internationalen und ständig bemanntenAußenposten der Menschheit im All. Die Geschichte der ISS beginnt1969 in den USA. Die junge WISSenschaft der Raumfahrt begeisterte nach der Mondlandungmindestens jeden zweiten Amerikaner. Umso erstaunlicher, dass die "US-Raumstationunter internationaler Beteiligung" fast dreißig Jahre lang auf ihre Umsetzung wartenmusste. Was im kollektiven Gedächtnis der Nachwelt über den geistigen Erfinder derStation Spiro Agnew haften blieb, ist vornehmlich sein etwas laxer Umgang mitSteuergeldern. Vielleicht auch deshalb gilt Präsident Ronald Reagan als der Vater derInternational Space Station. Vielleicht ist es aber auch einfach die lange Pause desProjekts. Fast siebzehn Jahre lang war die Idee durch NASA- und Pentagonschubladengewandert, bis die NASA 1984 den damaligen US-Präsidenten Reagan für das Vorhabengewinnen konnte. Dieser gab in jenem Jahr grünes Licht für die Umsetzung desGroßprojekts, das durch internationale Beteiligung bezahlbar werden und die Zukunft desamerikanischen Space Shuttle-Programms sichern sollte. Das ist der Startschuss für dieNASA, die sofort mit der Entwicklung der Station beginnt. Präsident Reagan gibt ihr denNamen "Freedom" und fordert international zur Teilnahme auf. Die kanadischeWeltraumorganisation CSA und die europäische Raumfahrtagentur ESA springen 1988 als ersteauf den fahrenden Zug; ein Jahr darauf folgen auch die technikbegeisterten Japaner deramerikanischen Einladung. Keine fünf Jahre später aber gerät das Raumfahrt-Projekternsthaft ins Trudeln. Der US-Kongress und Reagans Nachfolger Bill Clinton hatten denamerikanischen Raumfahrtvisionären auf die Finger geklopft, weil die Kosten für dasProjekt explodierten; die Entwicklungspläne müssen zusammengestrichen werden, soll dasVorhaben in der Haushaltsdebatte bestehen und das Parlament passieren. DasAlternativ-Konzept, das letzten Endes doch noch den parlamentarischen Segen desamerikanischen Kongresses erhielt, wird zum vorläufigenNamensgeber der komplettüberarbeiteten Station: Das Rennen macht das Entwicklungsprogramm "Alpha". 1994tritt Rußland der Baugemeinschaft bei. Aussteuer des verdienten Weltraum-Pioniers sinddie Baupläne der bis dato im Alleingang geplanten Raumstation MIR II. Die bis dahinunabhängigen Baupläne verschmelzen zu einem, die Namen "Alpha" und "MIRII" sind überholt. Das Ergebnis heißt plakativ nur noch "International SpaceStation", kurz ISS. Noch im selben Jahr dockt die amerikanische Space Shuttle an dierussische Raumstation MIR an und der Raum-Oldtimer wird zum Trainingscamp füramerikanische Astro- und russische Kosmonauten. Der 29.1.1998 schließlich ist der vonRaumfahrtlobbyisten und Forschungsministern jahrzehntelang zielstrebig vorbereitetegroßen Tag: Offizielle Vertreter von fünfzehn Ländern finden sich in Washington ein undsetzen ihre Paraphen unter das "Internationale Abkommen über den Bau und Betrieb desGemeinschaftsprojekts International Space Station." Der Bau der International SpaceStation Eine Raumstation entsteht wie ein Fertighaus: Große Baublöcke werdenvorproduziert, zusammengebaut wird vor Ort. Als die Trägerrakete PROTON am 20.11.1998 vonder gewaltigen Abschussrampe des russischen Weltraumbahnhofs Baikonur in den Kosmosaufgestiegen ist, begann die Montage der Internationalen Raumstation. An Bord der Proton:Der in russisch- amerikanischer Gemeinschaftsarbeit entwickelte Functional Cargo Block(FGB) oder auch Zarya Control Module genannt, der Grundstein der ISS. Das 23 Tonnenschwere Bauelement ist das Herz der wachsenden Station: Es wird sie Atmung allerdings angewiesen, was bedeutet, dass die Astronautenohne das bewährte Atemluftgemisch der Erde und den atmosphärischen Druck jämmerlichersticken würden. Im Raumschiff herrschen deshalb dieselben Druck- und LuftverhältnISSe,wie auf der Erde. Aber nicht nur das Vakuum, auch die Temperaturen machen das ReisezielKosmos nicht verlockend. Das All ist ein Temperatur-Abenteuer. Im Prinzip ist es extremkalt, deshalb besteht der Schutzanzug eines Astronauten aus mehreren Schichtenisolierenden Materials, das ihn vor dem Erfrieren schützt. Im Weltall ist es allerdingsnur deshalbextrem kalt, weil es leer ist. Die Strahlung der Sonne trifft, abgesehen vonden Planeten, auf nichts, was sie absorbieren und die Energie in Wärme umwandeln würde.Sofern aber ein Astronaut inmitten des Nichts anzutreffen ist, bietet sich eineUmwandlungsfläche. Dieser Fall würde für den Betroffenen ziemlich heiß werden, denndas, was auf der Erdoberfläche in einer durch 400 km Atmosphäre abgemilderten Formankommt, träfe ihn in ungemilderter Form. Raumschiff und Raumanzüge müssen dieAstronauten daher nicht nur vor extrem niedrigen, sondern auch vor extrem hohenTemperaturen schützen. Auch unter der Schutzglocke Erdatmosphäre nimmt der menschlicheKörper noch relativ viele Strahlen auf, wenn er der Sonne lange und ungeschütztausgesetzt wird. Dabei ist es nur ultraviolette Strahlung, die bis in die Troposphärevordringt, und auch noch in geringen Mengen. Man braucht schon etwas Fantasie, um sichvorzustellen, in welcher Verfassung ein menschlicher Körper aus der Konfrontation mit denweit gefährlicheren radioaktiven Gamma- und Röntgenstrahlen jenseits der Atmosphärehervorgehen würde. Diese Strahlen haben die unangenehme Eigenschaft, Elektronen ausAtomen herauszuschießen, gleichgültig, wem das Atom gehört. Physiker nennen den Vorgangwertneutral "ionisierende Wirkung" der radioaktiven Strahlung, vor der man denAstronauten sowohl im, als auch außerhalb des Raumschiffs bewahren muss. Daher ist esvielleicht kein Zufall, dass die Astronautenanzüge eine gewISSe ähnlichkeit haben mitden Schutzanzügen, die in Kernkraftwerken getragen werden - dieselbe Schutzrichtungsollten sie auf jeden Fall haben. Das 400km dicke Dach unseres Planeten kann man sich alsdichten Filter vorstellen, der in zwei Richtungen gleichzeitig arbeitet. Der Filter vonunten nach oben sorgt dafür, dass unten bleibt, was den Lebenskreislauf auf der Erde inGang hält, vornehmlich Luft und Wärme. Und in entgegengesetzter Richtung - von oben nachunten - wird ausgefiltert, was aus dem All nicht auf die Erde fallen soll. Zum Beispielschädliche Strahlen, praktischerweise aber auch fallende Himmelskörper: kleineMeteoriten oder - neuerdings - Weltraumschrott, kaputte Satelliten, verlorene Werkzeugeund abstürzende Teile ausrangierter Raumstationen, die meist in der Erdatmosphäreverglühen. Was aber bringt die ISS? Kritiker meinen nicht viel. Abgesehen von frischenAufträgen für die Raumfahrtindustrie, bunten Bildern aus dem All und noch mehr Müll inder Umlaufbahn. Die Bauherren sind naturgemäß anderer Meinung. Sie erwartenQuantensprünge in Sachen Technik und eine florierende industrielle Nutzung derErkenntnISSe aus dem All. Ohne Visionen kein Fortschritt, ohne Fortschritt keineArbeitsplätze, ohne Arbeitsplätze keine Zukunft. Allerdings räumten sie bereits ein,dass die WISSenschaft nicht Hauptnutznießer der ISS sein soll. Im Vordergrund stehe dieTechnik, Wirtschaft und industrielle Nutzung der ErkenntnISSe aus dem All. Deshalb seienauch die Kosten vertretbar. Die NASA hat dem amerikanischen Steuerzahler errechnet, dasser für jeden investierten Steuerdollar drei Dollar wieder zurückbekommt - über dieSteuergelder, die die Industrie vermehrt zahle, wenn die Umsätze dank der Forschung imAll stiegen. Wie der Bau der ISS selbst soll auch ein großer Teil der Forschungsvorhabenauf der Station der technologischen Entwicklung dienen. Neue Produkte, verbesserteProduktionsprozesse, Wettbewerbsvorteile, neue Jobs und höhere Lebensqualität. Dasin etwa sind die Schlagworte der beteiligten Staaten. Deutschland will unter anderem einenSender testen, mit dem per Satellit gestohlene Autos aufgespürt und lahmgelegt werdenkönnen. Das soll auch für Scheckkarten und Handys taugen. Der Praxistest im All kostet1,5 Millionen Mark. Es dürfte sich dabei um das einzige Vorhaben handeln, in
Atmung allerdings angewiesen, was bedeutet, dass die Astronautenohne das bewährte Atemluftgemisch der Erde und den atmosphärischen Druck jämmerlichersticken würden. Im Raumschiff herrschen deshalb dieselben Druck- und LuftverhältnISSe,wie auf der Erde. Aber nicht nur das Vakuum, auch die Temperaturen machen das ReisezielKosmos nicht verlockend. Das All ist ein Temperatur-Abenteuer. Im Prinzip ist es extremkalt, deshalb besteht der Schutzanzug eines Astronauten aus mehreren Schichtenisolierenden Materials, das ihn vor dem Erfrieren schützt. Im Weltall ist es allerdingsnur deshalbextrem kalt, weil es leer ist. Die Strahlung der Sonne trifft, abgesehen vonden Planeten, auf nichts, was sie absorbieren und die Energie in Wärme umwandeln würde.Sofern aber ein Astronaut inmitten des Nichts anzutreffen ist, bietet sich eineUmwandlungsfläche. Dieser Fall würde für den Betroffenen ziemlich heiß werden, denndas, was auf der Erdoberfläche in einer durch 400 km Atmosphäre abgemilderten Formankommt, träfe ihn in ungemilderter Form. Raumschiff und Raumanzüge müssen dieAstronauten daher nicht nur vor extrem niedrigen, sondern auch vor extrem hohenTemperaturen schützen. Auch unter der Schutzglocke Erdatmosphäre nimmt der menschlicheKörper noch relativ viele Strahlen auf, wenn er der Sonne lange und ungeschütztausgesetzt wird. Dabei ist es nur ultraviolette Strahlung, die bis in die Troposphärevordringt, und auch noch in geringen Mengen. Man braucht schon etwas Fantasie, um sichvorzustellen, in welcher Verfassung ein menschlicher Körper aus der Konfrontation mit denweit gefährlicheren radioaktiven Gamma- und Röntgenstrahlen jenseits der Atmosphärehervorgehen würde. Diese Strahlen haben die unangenehme Eigenschaft, Elektronen ausAtomen herauszuschießen, gleichgültig, wem das Atom gehört. Physiker nennen den Vorgangwertneutral "ionisierende Wirkung" der radioaktiven Strahlung, vor der man denAstronauten sowohl im, als auch außerhalb des Raumschiffs bewahren muss. Daher ist esvielleicht kein Zufall, dass die Astronautenanzüge eine gewISSe ähnlichkeit haben mitden Schutzanzügen, die in Kernkraftwerken getragen werden - dieselbe Schutzrichtungsollten sie auf jeden Fall haben. Das 400km dicke Dach unseres Planeten kann man sich alsdichten Filter vorstellen, der in zwei Richtungen gleichzeitig arbeitet. Der Filter vonunten nach oben sorgt dafür, dass unten bleibt, was den Lebenskreislauf auf der Erde inGang hält, vornehmlich Luft und Wärme. Und in entgegengesetzter Richtung - von oben nachunten - wird ausgefiltert, was aus dem All nicht auf die Erde fallen soll. Zum Beispielschädliche Strahlen, praktischerweise aber auch fallende Himmelskörper: kleineMeteoriten oder - neuerdings - Weltraumschrott, kaputte Satelliten, verlorene Werkzeugeund abstürzende Teile ausrangierter Raumstationen, die meist in der Erdatmosphäreverglühen. Was aber bringt die ISS? Kritiker meinen nicht viel. Abgesehen von frischenAufträgen für die Raumfahrtindustrie, bunten Bildern aus dem All und noch mehr Müll inder Umlaufbahn. Die Bauherren sind naturgemäß anderer Meinung. Sie erwartenQuantensprünge in Sachen Technik und eine florierende industrielle Nutzung derErkenntnISSe aus dem All. Ohne Visionen kein Fortschritt, ohne Fortschritt keineArbeitsplätze, ohne Arbeitsplätze keine Zukunft. Allerdings räumten sie bereits ein,dass die WISSenschaft nicht Hauptnutznießer der ISS sein soll. Im Vordergrund stehe dieTechnik, Wirtschaft und industrielle Nutzung der ErkenntnISSe aus dem All. Deshalb seienauch die Kosten vertretbar. Die NASA hat dem amerikanischen Steuerzahler errechnet, dasser für jeden investierten Steuerdollar drei Dollar wieder zurückbekommt - über dieSteuergelder, die die Industrie vermehrt zahle, wenn die Umsätze dank der Forschung imAll stiegen. Wie der Bau der ISS selbst soll auch ein großer Teil der Forschungsvorhabenauf der Station der technologischen Entwicklung dienen. Neue Produkte, verbesserteProduktionsprozesse, Wettbewerbsvorteile, neue Jobs und höhere Lebensqualität. Dasin etwa sind die Schlagworte der beteiligten Staaten. Deutschland will unter anderem einenSender testen, mit dem per Satellit gestohlene Autos aufgespürt und lahmgelegt werdenkönnen. Das soll auch für Scheckkarten und Handys taugen. Der Praxistest im All kostet1,5 Millionen Mark. Es dürfte sich dabei um das einzige Vorhaben handeln, in